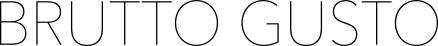Die konjunktivischen Gefäße des Keramikers Guido Sengle
Sie scheinen Idealbilder der Studiokeramik, die so zarten wie kräftigen Gefäße Guido Sengles: Sauberst gedrehte Kugelformen mit starker Wandung, Varianten von Zylindern und Ovoiden, Schalen, weit geöffnet kurzrandig oder hochwandig, aus Steinzeug oder Porzellan, Gefäße, angetan mit monochromer matter oder glänzender, oft pastellener Glasur, umlaufend gezeichnet von dunklem, tiefem Craquelée – stille Schönheit…
Doch was in klassischer Vollendung erscheint, hat oft ein wieder und wieder wandelndes Werden hinter sich, bleibt gar werdend, potentiell zumindest. Der Zustand gediegener Finalität trügt: Viele der perfekten Ideal-Gefäße sind über Jahre und Jahrzehnte durch unorthodoxe Nachbearbeitungsverfahren riskant modifiziert, ein Prozeß, in dem nicht weniges verdirbt, zu Bruch geht. Nicht allein färbt Guido Sengle das delikate Craquelée seiner Feldspat- und Gesteinsmehlglasuren nachträglich im kohlenstoffsatten Rauchbrand ein, er heizt Gefäße mitunter nochmals auf, um der dicken Glashaut mit kaltem Pressluftstrahl oder Eiswürfeln das Gesprüngel gezielt einzuschrecken – er nimmt Glasuren ihren Spiegelglanz, blendet die gleißenden Oberflächen mit Flußsäure zu samtener Mattheit – er dampft ihnen rötlich schimmernden Belaglüster auf – schlimmstenfalls schlägt er bei großen, aufgebauten, Gefäßen, Bodenvasen mit vielfarbigen impressionistisch-informellen Glasurbildern, die Glasschicht mit Hammer und Meißel wieder ab, um die Keramiken erneut zu glasieren und zu brennen.
Da hilft keine Regel, nur Maßlosigkeit: Allein geleitet von einem Je-ne-sais-quoi wie ein Maler, der zurücktretend von der Leinwand, sein Bild für beendet erklärt oder aber übermalt, nach Jahren vielleicht erst, ist auch der Keramiker unendlich verführt von namenloser, entwischender Schönheit: Das ideale Gefäß bleibt im Konjunktiv – und ist gerade darum immer möglich…
Walter Lokau, Bremen Juli 2019